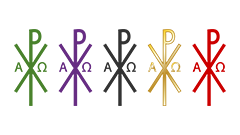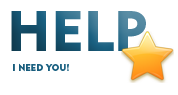Das evangelische Kirchenjahr 1941/1942
Verzeichnis aller Fest- und Gedenktage im Jahr
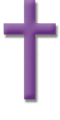
Das evangelische Kirchenjahr
Verzeichnis aller Sonntage, Festtage und Gedenktage im Jahreslauf
für das gewählte Kirchenjahr
1941/1942
vom 1. Advent 1941 bis zum Ewigkeitssonntag 1942
sowie für das Folgejahr in tabellarischer Übersicht
mit allen nötigen Verweisen auf die zugehörigen Artikel, Beiträge und Kalenderblätter
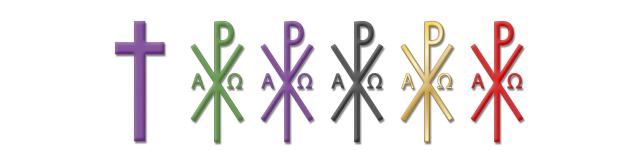
Inhalt dieser Seite
- 1. Einleitung: Die Sonntage, Festtage und Feiertage im Jahreslauf
- 2.1: Die Adventszeit
- 2.2: Die Weihnachtszeit
- 2.3: Die Zeit nach Epiphanias
- 2.4: Die Zeit vor der Passion
- 2.5: Die Passionszeit
- 2.6: Das heilige Osterfest und die österliche Freudenzeit
- 2.7: Das heilige Pfingstfest
- 2.8: Die Zeit nach Trinitatis bis zum Ende des Kirchenjahres
- 2.9: Die unbeweglichen Feste und Gedenktage
- 2.10: Feste ohne allgemein bestimmtes Datum
- 3. Anhänge
- 3.1 Anmerkung zu den Sonntagen der Trinitatiszeit
- 3.2 Legende zu den Tabellen
- 3.3 Die liturgischen Farben und ihre Bedeutung
- 4. Erläuterungen
- 4.1 Das Kirchenjahr in den Tabellen
Tabellarische Übersichten
Wir zeigen in einer ersten Tabelle die beweglichen Sonntage, Festtage und Feiertage im Kirchenjahr.
In einer zweiten Tabelle sind anschließend die Daten der unbeweglichen, meist kleineren Feste und Gedenktage zusammengestellt. Es folgen besondere Anlässe, für die allgemein kein Datum festgelegt ist. Sie erscheinen im Gottesdienstkalender der Gemeinden nach Bedarf bzw. nach gepflegter Tradition.
Bitte beachten Sie weitergehende Erläuterungen zu den Informationen in den Tabellen am Ende dieser Seite!
Die Adventszeit | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
|---|---|---|---|---|
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Jahreswechsel im Kirchenjahr | ||||
1. Sonntag des Advents Erster Tag im Kirchenjahr 27. November bis 3. Dezember | B | |||
2. Sonntag des Advents 3. Sonntag vor dem 1. Weihnachtstag 4. Dezember bis 10. Dezember | B | |||
3. Sonntag des Advents 2. Sonntag vor dem 1. Weihnachtstag 11. Dezember bis 17. Dezember | B | |||
4. Sonntag des Advents Sonntag vor dem 1. Weihnachtstag 18. Dezember bis 24. Dezember | B | |||
Das heilige Christfest: Die Weihnachtszeit | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Erster Weihnachtstag Heiliger Christtag 1. Weihnachtstag 25. Dezember | F | |||
2. Weihnachtstag 2. Weihnachtstag Der 2. Weihnachtstag kann auch als Stephanustag gefeiert werden (s. u.) 26. Dezember | F | |||
Sonntag nach Weihnachten 1. Sonntag nach dem 4. Advent Wird gottesdienstlich nur als Sonntag begangen, wenn er zwischen dem 27. und 31. Dezember liegt. 27. Dezember bis 31. Dezember | B | |||
Jahreswechsel im bürgerlichen Kalender | ||||
Neujahrstag Erster Tag im bürgerlichen Kalenderjahr 1. Januar | F | |||
Sonntag nach Neujahr Entfällt, wenn er auf 2. Januar bis 5. Januar | B | |||
Epiphaniasfest Das Epiphaniasfest sollte am 6. Januar gefeiert werden. Ist dies nicht möglich, kann es vor- oder nachgefeiert werden. 6. Januar | F | |||
Die Zeit nach Epiphanias | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
1. Sonntag nach Epiphanias 7. Januar bis 13. Januar | B | |||
2. Sonntag nach Epiphanias Entfällt, wenn Ostern vor dem 25. März liegt 14. Januar bis 20. Januar | B | |||
3. Sonntag nach Epiphanias Entfällt, wenn Ostern vor dem 1. April liegt (Schaltjahr: 31.März). 21. Januar bis 27. Januar | B | |||
4. Sonntag nach Epiphanias Entfällt, wenn Ostern vor dem 8. April liegt (Schaltjahr: 7. April). 28. Januar bis 3. Februar | B | - entfällt - | ||
5. Sonntag nach Epiphanias Entfällt, wenn Ostern vor dem 15. April liegt (Schaltjahr: 14. April). 4. Februar bis 10. Februar | B | - entfällt - | ||
6. Sonntag nach Epiphanias Entfällt, wenn Ostern vor dem 22. April liegt (Schaltjahr: 21. April). 11. Februar bis 14. Februar | -70 | - entfällt - | ||
Die Zeit vor der Passionszeit | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Sonntag 3. Sonntag vor der Fasten 18. Januar bis 21. Februar | -63 | |||
Sonntag 2. Sonntag vor der Fasten 25. Januar bis 28. Februar | -56 | |||
Sonntag vor der Fasten Quinquagesimä Sonntag vor Aschermittwoch 1. Februar bis 7. März | -49 | |||
Die Passionszeit | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Aschermittwoch Beginn der Passionszeit Ohne liturgische Bedeutung im evangelischen Kirchenkalender 4. Februar bis 10. März | -46 | |||
1. Sonntag in der Fasten Invokavit 6. Sonntag vor Ostern 8. Februar bis 14. März | -42 | |||
2. Sonntag in der Fasten Reminiszere 5. Sonntag vor Ostern 15. Februar bis 21. März | -35 | |||
3. Sonntag in der Fasten Okuli 4. Sonntag vor Ostern 22. Februar bis 28. März | -28 | |||
4. Sonntag in der Fasten Lätare 3. Sonntag vor Ostern 1. März bis 4. April | -21 | |||
5. Sonntag in der Fasten Judika 2. Sonntag vor Ostern 8. März bis 11. April | -14 | |||
6. Sonntag in der Fasten Palmarum Sonntag vor Ostern 15. März bis 18.April | -7 | |||
Gründonnerstag Donnerstag vor dem heiligen Ostertag 19. März bis 22. April | -3 | |||
Karfreitag Freitag vor Ostersonntag 20. März bis 23. April | -2 | |||
Das heilige Osterfest und die österliche Freudenzeit | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Der heilige Ostertag Ostersonntag 22. März bis 25. April | 0 | |||
Ostermontag Montag nach Ostersonntag 23. März bis 26. April | +1 | |||
Quasimodogeniti 1. Sonntag nach Ostern 29. März bis 2. Mai | +7 | |||
Miserikordias Domini 2. Sonntag nach Ostern 5. April bis 9. Mai | +14 | |||
Jubilate 3. Sonntag nach Ostern 12. April bis 16. Mai | +21 | |||
Kantate 4. Sonntag nach Ostern 19. April bis 23. Mai | +28 | |||
Rogate 5. Sonntag nach Ostern 26. April bis 30. Mai | +35 | |||
Himmelfahrt Christi Am 40. Tag gerechnet ab Ostersonntag, ein Donnerstag 30. April bis 3. Juni | +39 | |||
Exaudi 6. Sonntag nach Ostern 3. Mai bis 6. Juni | +42 | |||
Das heilige Pfingstfest | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Der heilige Pfingsttag Am 50. Tag gerechnet ab Ostersonntag, 10. Mai bis 13. Juni | +49 | |||
Pfingstmontag Am 51. Tag gerechnet ab Ostersonntag 11. Mai bis 14. Juni | +50 | |||
Trinitatis Sonntag nach Pfingsten 17. Mai bis 20. Juni | +56 | |||
Die Zeit nach Trinitatis | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
1. Sonntag nach Trinitatis 24. Mai bis 27. Juni | +63 | |||
2. Sonntag nach Trinitatis 31. Mai bis 4. Juli | +70 | |||
3. Sonntag nach Trinitatis 7. Juni bis 11. Juli | +77 | |||
4. Sonntag nach Trinitatis 14. Juni bis 18. Juli | +84 | |||
5. Sonntag nach Trinitatis 21. Juni bis 25. Juli | +91 | |||
6. Sonntag nach Trinitatis 28. Juni bis 1. August | +98 | |||
7. Sonntag nach Trinitatis 5. Juli bis 8. August | +105 | |||
8. Sonntag nach Trinitatis 12. Juli bis 15. August | +112 | |||
9. Sonntag nach Trinitatis 19. Juli bis 22. August | +119 | |||
10. Sonntag nach Trinitatis 26. Juli bis 29. August | +126 | |||
11. Sonntag nach Trinitatis 2. August bis 5. September | +133 | |||
12. Sonntag nach Trinitatis 9. August bis 12. September | +140 | |||
13. Sonntag nach Trinitatis 16. August bis 19. September | +147 | |||
14. Sonntag nach Trinitatis 23. August bis 26. September Fällt der 29. September (Michaelistag) in die Woche nach diesem Sonntag, dann wird der 14. Sonntag nach Trinitatis als »Tag des Erzengels Michael und aller Engel« gefeiert. | +154 | |||
15. Sonntag nach Trinitatis 30. August bis 3. Oktober | +161 | |||
16. Sonntag nach Trinitatis 6. September bis 10. Oktober | +168 | |||
17. Sonntag nach Trinitatis 13. September bis 17. Oktober | +175 | |||
18. Sonntag nach Trinitatis 20. September bis 24. Oktober | +182 | |||
19. Sonntag nach Trinitatis 27. September bis 31. Oktober | +189 | |||
20. Sonntag nach Trinitatis
4. Oktober bis 7. November | B | |||
21. Sonntag nach Trinitatis
11. Oktober bis 14. November | B | |||
22. Sonntag nach Trinitatis
18. Oktober bis 21. November | B | Dies ist der letzte Sonntag in diesem Kirchenjahr | ||
23. Sonntag nach Trinitatis Nur vorhanden, wenn Ostern vor dem 24. April liegt. 25. Oktober bis 26. November | B | - entfällt - | ||
24. Sonntag nach Trinitatis Nur vorhanden, wenn Ostern vor dem 17. April liegt. 1. November bis 26. November | B | - entfällt - | ||
25. Sonntag nach Trinitatis Nur vorhanden, wenn Ostern vor dem 10. April liegt. 8. November bis 26. November | B | Dies ist der letzte Sonntag in diesem Kirchenjahr | - entfällt - | |
26. Sonntag nach Trinitatis Nur vorhanden, wenn Ostern vor dem 3. April liegt. 15. November bis 26. November | B | - entfällt - | - entfällt - | |
27. Sonntag nach Trinitatis Nur vorhanden, wenn Ostern vor dem 27. März liegt. B: 22. November bis 26. November | B | - entfällt - | - entfällt - | |
Totensonntag Am letzten Sonntag des Kirchenjahres Sonntag vor dem 1. Advent 20. November bis 26. November | B | |||
| Ende des Kirchenjahres Samstag vor dem 1. Advent, an dem das neue Kirchenjahr beginnt Ohne liturgische Bedeutung im Festtagskalender der evangelischen Kirchen 26. November bis 2. Dezember | B | ||
Ende des Kirchenjahres | ||||
Unbewegliche Feste und Gedenktage. Erntedank. | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr Verweise zu den Kalendereinträgen | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
26. Dezember Stephanustag Tag des Erzmärtyrers Stephanus | F | |||
2. Februar Tag der Darstellung Jesu im Tempel | F | |||
25. März Tag der Verkündigung Marias | F | |||
24. Juni Johannisfest | F | |||
2. Juli Tag der Heimsuchung Mariä | F | |||
29. September Michaelistag | F | |||
Erntedankfest Sonntag nach dem Michaelistag 1. Oktober bis 7. Oktober | B | |||
31. Oktober Reformationsfest Luther veröffentliche am 31.10.1517 einen Zettel mit seinen 95 Thesen. Sie bildeten die Grundlage der reformatorischen Bewegung. | F | |||
Buß- und Bettag Mittwoch vor dem Totensonntag 16. November bis 22. November | B | |||
Besondere Anlässe im Kirchenjahr | ||||
| Verweis zum Artikel | Name und Bedeutung | Δ | Datum im Kirchenjahr | |
| 1941/1942 Gewähltes Jahr | 1942/1943 Folgendes Jahr | |||
Kirchweih Abhängig vom lokalen Festtagskalender der Gemeinden | B | Kein allgemein festgelegtes Datum! | Kein allgemein festgelegtes Datum! | |
Legende zu den Tabellen:
Die Kirchenjahre 1941/1942 und 1942/1943
In unseren Tabellen finden Sie in der kalendarischen Reihenfolge die Sonntage und Feiertage des Kirchenjahrs mit den konkreten Datumsangaben für das aktuell gewählte Kirchenjahr 1941/1942 und für das folgende Kirchenjahr 1942/1943.
Das aktuell gewählte Kirchenjahr 1941/1942 beginnt in der Tabelle mit dem 1. Adventssonntag 1941 (![]() Sonntag, der 30.11.1941) und endet am
Sonntag, der 30.11.1941) und endet am ![]() Samstag, den 28.11.1942.
Samstag, den 28.11.1942.
Die Informationen in den Spalten bedeuten:
- Spalte 1 (»Verweis zum Artikel«): Die Verweise (»Links«) hinter den Bildern führen zu unseren Artikeln mit Erläuterungen und Informationen zum jeweiligen evangelischen Sonntag oder Feiertag.
- Spalte 2 (»Name und Bedeutung«): Name des Tages, besondere Hinweise und Regeln sowie das Datum oder bei beweglichen Daten der Datumsbereich, in dem der jeweilige Sonntag oder Feiertag im Kalender erscheinen kann.
- Spalte 3 (»Δ«):Verschiedene Informationen zum Tag:
- Zahl: Abstand des jeweiligen Sonn- oder Feiertages zum Osterfest, sofern er fest und unveränderlich ist.
- Ostern enthält dort die Zahl Null,
- Tage vor Ostern sind negativ,
- Tage nach Ostern positiv gezählt.
- Ein »F« in dieser Spalte markiert ein festes, unbewegliches Datum (z. B. ist Heiligabend immer der 24. Dezember).
- ein »B« markiert ein bewegliches Datum (z. B. fällt der 1. Advent von Jahr zu Jahr auf ein anderes Kalenderdatum).
- Die 3. Spalte zeigt zudem die liturgische Farbe an, die dem jeweiligen Tag zugeordnet ist.
- Zahl: Abstand des jeweiligen Sonn- oder Feiertages zum Osterfest, sofern er fest und unveränderlich ist.
-
Spalten 4 und 5(»Datum im Kirchenjahr«): Das tatsächliche Tagesdatum im Kalender. Die Verweise dahinter führen zu den zugehörigen Kalenderblättern des jeweiligen Tages.

Es ist möglich, dass in einem Kirchenjahr ein evangelischer Sonntag, Feiertag oder Gedenktag nicht vorkommt bzw. entfällt.

Es können für diesen Tag auch besondere Regeln gelten, auf die dann in diesen Spalten verwiesen wird.
- Spalte 4: Datum des evangelischen Tages im gewählten Kirchenjahr.
- Spalte 5:
- In der Standardausgabe wird das Datum des Sonn- oder Feiertags im folgenden Kirchenjahr angezeigt.
- In der vergleichenden Ausgabe wird das Datum des gewählten Kirchenjahres auf Grundlage des julianischen Kalenders angezeigt (nur für Kirchenjahre ab 1582/1583).
Die liturgischen Farben und ihre Bedeutung
Die liturgischen Farben, wie sie heute in deutschen evangelischen Kirchen für den Tuchschmuck (»Antependium«, Vorhang) des Altars, der Kanzel und des Lesepults verwendet werden, informiert der folgende Artikel:
Wissenswertes
 Die liturgischen Farben
Die liturgischen Farben
Der Artikel erklärt die Farben, wie sie in evangelischen Kirchen für den Tuchschmuck des Altars, der Kanzel und des Lesepults verwendet werden.
Das Kirchenjahr in den Tabellen
Einleitung
Das Kirchenjahr
Anders als das bürgerliche Kalenderjahr beginnt das Kirchenjahr am ![]() 1. Advent und endet am Samstag vor dem 1. Advent im darauffolgenden Kalenderjahr. Der
1. Advent und endet am Samstag vor dem 1. Advent im darauffolgenden Kalenderjahr. Der ![]() Ewigkeitssonntag (Totensonntag), bzw. der letzte Sonntag nach Trinitatis, ist zugleich der letzte Sonntag im Kirchenjahr.
Ewigkeitssonntag (Totensonntag), bzw. der letzte Sonntag nach Trinitatis, ist zugleich der letzte Sonntag im Kirchenjahr.
Wir bezeichnen daher das Kirchenjahr immer mit zwei Jahreszahlen. Das von Ihnen gerade betrachtete Kirchenjahr beginnt am 1. Adventssonntag 1941 (![]() 30.11.1941) und endet am
30.11.1941) und endet am ![]() Samstag, den 28.11.1942. Es trägt daher die Bezeichnung »Kirchenjahr 1941/1942«.
Samstag, den 28.11.1942. Es trägt daher die Bezeichnung »Kirchenjahr 1941/1942«.
Die Einteilung des Kirchenjahres
Dieses Kirchenjahr wird in Abschnitte unterteilt:
- Die Adventszeit
- Das heilige Christfest; Jahreswende und Epiphaniasfest: Weihnachten
- Die Zeit »Nach Epiphanias«
- Die Zeit »Vor der Passionszeit«
- Die Passionszeit
- Das heilige Osterfest und die österliche Freudenzeit
- Das heilige Pfingstfest
- Die Zeit »Nach Trinitatis«
Zwei Tabellen
Wir zeigen in einer ersten Tabelle die beweglichen Sonntage, Festtage und Feiertage gruppiert nach dieser Einteilung im Kirchenjahr.
In einer zweiten Tabelle sind die Daten der unbeweglichen, meist kleineren Feste und Gedenktage zusammengestellt, die nicht an einem bestimmten Sonntag hängen.
Zeitliche Anpassungen
Bis in die heutige Zeit hinein sind in den evangelischen Kirchen die Kirchenordnungen nicht einheitlich. Je weiter wir in die Vergangenheit blicken, desto stärker differenzieren sich regionale Kirchenordnungen sowie gemeindlich geübte, regionale Praxis. So ist das Feiern bestimmter Gedenktage nicht derart gesichert, dass sie als Tage im Kirchenjahr in unseren Kalendern vollständig und historisch korrekt berücksichtigt werden konnten.
Zusätzlich hat sich über die Jahrhunderte hinweg der Verlauf des Kirchenjahres mehrfach signifikant geändert. Die letzte Änderung wurde mit der »Neuordnung der gottesdienstlichen Texte und Lieder« im November 2017 beschlossen, die ab 2018/2019 nicht nur die Text- und Liederzuordnungen, sondern auch den Verlauf des Kirchenjahres an mehreren Stellen gegenüber der Kirchenordnung von 1978/1979 ändert und um mehrere Gedenktage erweitert.
Namen, Daten und Regeln
Unsere Tabellen zeigen Namen, Daten und Regeln der Sonn- und Feiertage im Kirchenjahr gemäß der (überwiegend) gültigen Ordnungen ihrer Zeit.
So gibt es beispielsweise ab 1978/1979 in allen Landeskirchen drei feste Sonntage am Ende des Kirchenjahres und daher höchstens 24 Sonntage nach Trinitatis. In den Jahren davor wurde es unterschiedlich gehandhabt. Es gab bis zu 27 Sonntage nach Trinitatis (abhängig vom Datum des Osterfestes und des 1. Weihnachtsfeiertags im selben Kalenderjahr), aber weniger bzw. keine festen Sonntage, die das Kirchenjahr beenden.
Ein zweites Beispiel: Es gibt ab 1978/1979 eine ganze Reihe kleiner Fest- und Gedenktage, (speziell die Gedenktage der Apostel), die zuvor womöglich gemeindlich gefeiert wurden, aber keinen Niederschlag in liturgischen Kalendern oder Perikopenordnungen fanden.
Ein drittes Beispiel: Die Zahl dieser kleinen Gedenktage wurde mit der Neuordnung ab 2018/2019 um weitere sieben Tage gegenüber 2017/2018 erhöht.
Unsere Kalender versuchen, diese kirchenepochalen Unterschiede mindestens grob zu erfassen und abzubilden. Dafür haben wir zahlreiche historische Liturgie- und Perikopenordnungen ausgewertet (soweit sie uns verfügbar waren). Dennoch können wir viele Besonderheiten nicht darstellen. Dies beginnt bei der Zuordnung der liturgischen Farben in den Jahren vor 1978/1979 und endet nicht zuletzt bei der Berücksichtigung der Apostelfeste und Märtyrertage und weiterer Gedenktage, die bei Reformierten und Lutheranern und über die Jahrhunderte hinweg sicherlich unterschiedlich gehandhabt wurden.
Die historischen Daten unseres Kalenders stellen also gerade für Jahre vor 1978/1979 nicht den tatsächlichen Zustand des Kirchenjahres in einer bestimmten evangelischen Landeskirche oder Region dar, kommen ihm aber nahe. Sie sind gedacht als Quelle, um sich konkreten Zeiträumen anzunähern, von denen alte Urkunden und Kirchenbücher berichten.
Abweichungen können sich schlicht darin begründen, dass für dasselbe Datum andere kirchliche (oder lokale bürgerliche) Bezeichnungen verwendet wurden, dass andere Jahresanfänge galten, dass anstelle der gregorianischen die julianische Zeitrechnung zugrunde gelegt wurde, usw. Abweichungen sind auch dort zu erwarten, wo protestantische Lehren (z. B. Reformierte, Lutheraner) maßgeblich das Kirchenjahr durch die Gestaltung von Gottesdiensten und durch das Feiern oder Auslassen von Gedenktagen betonten.
Wir hoffen, mit späteren Updates diese Informationen Stück für Stück bieten zu können, sofern sie für unsere Zielgruppen bedeutsam sind und sofern sich das Ergebnis noch überschaubar und für den Leser nutzbringend darstellen lässt.
Neue Kirchenordnungen entstanden nie von heute auf morgen. Ihnen gingen stets Jahre des Ausprobierens und Experimentierens mit neuen Modellen voraus, die sich aus der Kritik am Bestehenden entwickelten. Solche Phasen des Umbruchs hatten sicherlich in Gemeinden (und Kirchenbüchern) praktisch Relevanz, sie lassen sich aber in diesen Kalendern nicht darstellen.
Zwei Kirchenjahre in der Übersicht
Unser Anspruch war es, zwei Kirchenjahre abzubilden. Je nach gewählter Ausgabeart zeigen unsere Tabellen:
- in der Standardausgabe das aktuell gewählte Kirchenjahr und das direkt nachfolgende Kirchenjahr, um Verschiebungen und Besonderheiten, die sich aus der Lage der Tage Weihnachten, Epiphanias und Ostern ergeben, leichter ausmachen zu können;
- in der vergleichenden Ausgabe (ab 1583) nur das aktuell gewählte Kirchenjahr, jedoch einmal im gültigen (gregorianischen) Kalender und einmal nach julianischer Zeitrechnung.
Dies dürfte insbesondere Historiker und Genealogen interessieren und für sie ein nützliches Werkzeug sein. Denn noch lange nach offizieller Einführung des gregorianischen Kalenders waren Zeitrechnungen und Beurkundungen (gerade in evangelischen Kirchenbüchern) überwiegend nach dem julianischen Kalender üblich als Folge davon, alles Römisch-katholische abzulehnen.
Veränderlich und feste Längen der Zeiten
Bewegliche Länge in der Advents-, Weihnachts- und Epiphaniaszeit
Die ![]() Adventszeit umfasst zwar immer vier Sonntage, dennoch schwankt ihre Länge abhängig vom Wochentag, auf den der
Adventszeit umfasst zwar immer vier Sonntage, dennoch schwankt ihre Länge abhängig vom Wochentag, auf den der ![]() 1. Weihnachtstag fällt, zwischen 22 und 28 Tagen.
1. Weihnachtstag fällt, zwischen 22 und 28 Tagen.
Die Länge der Adventszeit wirkt sich auf die Zahl der Sonntage (1 oder 2) zwischen ![]() Heiligabend und
Heiligabend und ![]() Epiphanias aus.
Epiphanias aus.
In den Jahren bis 2017/2018 stellen die Sonntage nach Epiphanias zusammen mit den Sonntagen nach ![]() Trinitatis den Puffer für die Verschiebungen der Passions- und Osterzeit im Kalender dar. Nur der
Trinitatis den Puffer für die Verschiebungen der Passions- und Osterzeit im Kalender dar. Nur der ![]() Letzte Sonntag nach Epiphanias ist immer vorhanden, alle anderen können je nach Lage des Osterfestes entfallen.
Letzte Sonntag nach Epiphanias ist immer vorhanden, alle anderen können je nach Lage des Osterfestes entfallen.
Ab dem Kirchenjahr 2018/2019 wird die Pufferfunktion im Wesentlichen durch die Zahl der Sonntage in der Vorpassionszeit bestimmt. Während die Epiphaniaszeit (6. Januar bis letzter Sonntag nach Epiphanias) immer vier Sonntage umfasst, schwankt die Zahl der Sonntage in der Vorpassion zwischen 0 und 5, abhängig vom Osterdatum.
Feste Länge der Zeit zwischen dem Letzten Sonntag nach Epiphanias und dem Sonntag Trinitatis
In den Jahren bis 2017/2018 ist die Zahl der Sonntage zwischen dem Letzten Sonntag nach Epiphanias und Trinitatis ist immer gleich. Die Zahl der Tage in dieser Zeit verändert sich nur in ![]() Schaltjahren, wenn mit dem
Schaltjahren, wenn mit dem ![]() 29. Februar ein Tag hinzukommt.
29. Februar ein Tag hinzukommt.
Ab dem Kirchenjahr 2018/2019 beschränkt sich die feste Länge auf die Zeit zwischen dem Sonntag Invokavit (1. Sonntag der Passionszeit) und dem Sonntag Trinitatis aufgrund der Änderungen in der Epiphaniaszeit und der Vorpassionszeit.
Bewegliche Länge der Zeit nach Trinitatis
Abhängig vom Datum des Ostersonntags schwankt die Anzahl der Sonntage nach Trinitatis. Es kann insgesamt 22 bis 27 Sonntage nach Trinitatis geben einschließlich der drei letzten Sonntage des Kirchenjahres.
Die Namen der drei letzten Sonntage nach Trinitatis lauten erst in jüngerer Zeit »Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres«, »Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres« (das ist gleichzeitig der Volkstrauertag) und »Letzter Sonntag des Kirchenjahres« (das ist der Ewigkeitssonntag).
In älteren Kirchenordnungen werden die Sonntage nach Trinitatis bis zum Ende durchgezählt. Hier hilft dann nur der Blick auf den 1. Advent desselben Kalenderjahres, um festzustellen, wie viele Sonntage nach Trinitatis zu zählen sind. Doch hatte sich schon früh für den letzten Sonntag des Kirchenjahres die Notwendigkeit abgezeichnet, ihm einen festlichen Charakter zu geben. So nennt ihn die Waldecker Kirchenordnung von 1556 »Fest des jüngsten Tages«. Alte Kirchenbücher könnten diese oder ähnliche Bezeichnungen für den letzten Sonntag der Trinitatiszeit vermerkt haben.