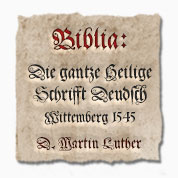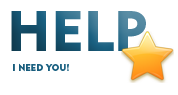Wörterbuch zur Lutherbibel
XVI. Band, Buchstabe R
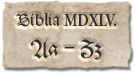
Wörterbuch zur Lutherbibel 1545

Das große Stilkunst.de
Wörterbuch
zur Lutherbibel von 1545
Luther-Deutsch – Deutsch
XVI. Band
Buchstabe
R
Register
Verzeichnis der Namen, Wörter und Begriffe
Sortierfolge der Wörter
Aktuelle Sortierfolge:
![]() Luther-Deutsch – Deutsch
Luther-Deutsch – Deutsch
Wählbare Sortierfolge:
![]() Deutsch – Luther-Deutsch
Deutsch – Luther-Deutsch
Wählen Sie einen Eintrag im Register, um zum zugehörigen Artikel zu blättern.
Einträge: 33
Luther-Deutsch | Deutsch | Luther-Deutsch | Deutsch | |
R, r | reiſſen | |||
Rabſake | Reuchopffer | |||
Rabſake | Reuchopffer | |||
Racha | rewen | |||
raffeln | Rhordomel | |||
raffen | rhümeſtu | |||
ratſchlahen | Rhumredtige | |||
Rebecca | richteſtu | |||
recht | Riebe | |||
rechten | Riſe | |||
redeſtu | Riſs | |||
Reiger | Roſs | |||
Reiger | Roſs | |||
rein abe | Rotte | |||
reiſen | Ruge | |||
reiſig | rugen | |||
Reiſig | ||||
Artikel aus
Band XVI |
Buchstabe R
Namen, Wörter und Begriffe
Luther-Deutsch |
Deutsch | Erläuterungen |
||||||||||||||||||
R, r |
R, r (Buchstabe) In unseren Texten kommen folgende Formen vor:
Hinweise
Der Großbuchstabe »R« der Frakturschrift sollte nicht mit dem »K« verwechselt werden. Hier nebeneinander im Vergleich »R« (links) und »K« (rechts) aus dem Zeichensatz für Fließtext:
R | K
Der Kleinbuchstabe »r« der Frakturschrift sollte nicht mit dem »x« verwechselt werden. Hier nebeneinander im Vergleich »r« (links) und »x« (rechts) aus dem Zeichensatz für Fließtext:
r | x
Das »x« ist an seiner schmalen, nach links unten gezogenen Unterlänge erkennbar, während die Grundformen von »r« und »x« oberhalb der Basislinie praktisch identisch sind.
Der Großbuchstabe »R« der Frakturschrift für Überschriften sollte nicht mit dem »E« verwechselt werden. Hier nebeneinander im Vergleich »R« (links) und »E« (rechts) aus dem Zeichensatz für Überschriften:
R | E
©Die bei Stilkunst.de verwendeten Zeichensätze (Font-Familien SK-Biblia1545 und SK-Biblia1534 inklusive der Ornament-Fonts) wurden nach Drucken der Lutherbibeln von 1545 und 1534 neu entwickelt und werden weiter an die von Drucker Hans Lufft verwendeten Typen angepasst. ©by Reiner Makohl | www.stilkunst.de
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Rabſake
RabSake |
Rabsake (Titel) Rabschake (Titel) Rabſake
* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. RabSake
* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.
Rabsake oder Rabschake ist die Transkription eines zusammengesetzten, hebräischen Begriffs (רַב־שָׁקֵ֔ה, rab-šͻqeh), der etwa »der mächtige Mundschenk«, der »Obermundschenk« bedeutet.
Luther hat dieses Wort mit Ertzſchencke übersetzt.
Gebildet ist Ertzſchencke aus der Vorsilbe »Erz-«, die bei Titeln von Personen ausdrückt, dass jemand in der bezeichneten Position erhaben ist, und »(Mund-)Schenk«. Der Titel meint demnach in etwa Obermundschenk, Chef-Mundschenk. Ließen sich die Berufe vergleichen, wäre das heute womöglich ein Chef-Sommelier.
Belegt ist das Wort ausschließlich in 2Kon 18,17 sowie in Jes 36,2, wo ein Bote des assyrischen Königs Sanherib zum judäischen König Hiskia nach Jerusalem reist. Der Bote trägt den (assyrischen) Titel »Rabschake«. Diesen Titel führt Luther in beiden Textabschnitten einmal an und notiert in den zugehörigen Marginalspalten, dass dies auf Deutsch »Ertzschenke« bedeute. Ab diesen Anmerkungen verwendet er den Begriff »Ertzschencke« jeweils im laufenden Text.
In seiner Anmerkung (Marginalspalte) zu
Siehe:
VND der könig von Aſſyrien ſandte Tharthan vnd den Ertzkemerer / vnd den Rabſake von Lachis zum könige Hiskia
a) Und der König von Assyrien sandte Tharthan und den Erzkämmerer sowie den Rabsake [oder: Rabschake] von Lachis zum König Hiskia b) Und der König von Assyrien sandte Tharthan und den Erzkämmerer sowie den Erzschenken [oder: Obermundschenk] von Lachis zum König Hiskia
Vnd der König zu Aſſyrien ſandte den a Rabſake von Lachis gen Jeruſalem zu dem könige Hiskia mit groſſer macht /
a) Und der König zu Assyrien sandte den Rabsake [oder: Rabschake] von Lachis gen Jerusalem zum König Hiskia, ausgestattet mit großer Heeresmacht b) Und der König zu Assyrien sandte den Obermundschenk [oder: Chef-Mundschenk] von Lachis gen Jerusalem zum König Hiskia, ausgestattet mit großer Heeresmacht
SK Version 21.12.2024 ● |
||||||||||||||||||
Racha |
Raka griechisch: ῤακά (rhaka)
Ein Schimpfwort, das in der Bibel nur in
Luther weist in seinem Scholion darauf hin, dass damit wohl ein harmloser »Trottel«, »Faulenzer« oder »Dummkopf« gemeint sei (unbewusste oder passive Eigenschaft), denn das Schimpfwort »Narr« sei schlimmer, weil es einen Menschen bezeichnet, der zudem Schaden anrichtet (bewusste oder aktive Eigenschaft).
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
raffeln |
raffeln (Verb; veraltet) die Raffel (eine Klapper) benutzen
1. klappern, rasseln 2. raspeln (z. B. Gemüse)
raffeln
* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.
Hier allerdings als Intensivum zu
DA aber Paulus einen hauffen Reiſer zuſamen raffelt / vnd legt es auffs fewr / kam ein Otter von der hitze / vnd fuhr Paulo an ſeine Hand.
Als aber Paulus einen Haufen Reiser bündelte und ihn ins Feuer legte, kam, von der Hitze [angelockt], eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
raffen |
raffen (Verb) heftig und begehrlich ergreifen, an sich reißen, wegnehmen
Hiob 27,19: mit raffen (mitraffen) Psalm 26,9: Hab 1,9: zuſamen raffen (zusammenraffen) 2Makk 5,16: raffet ... hinweg (hinwegraffen)
wie der Tod / der nicht zu ſettigen iſt / Sondern rafft zu ſich alle Heiden / vnd ſamlet zu ſich alle völcker.
wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Der zu sich rafft alle fremden Völker und alle Nationen bei sich versammelt.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
ratſchlahen |
ratschlagen (Verb) Sie machen liſtige anſchlege wider dein Volck / Vnd ratſchlahen wider deine Verborgene.
Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und ratschlagen gegen die, die bei dir geborgen sind.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Rebecca |
Rebekka (Name) auch: Rebecca
hebräisch: רִבְקָה (Ribekah) lateinisch: Rebecca griechisch: Ῥεβέκκα
Frau Rebekka verhilft ihrem jüngeren Sohn Jakob dazu, den Erstgeburtssegen von seinem inzwischen erblindeten Vater Isaak zu erschleichen, indem er sich mit einer List als sein Bruder Esau ausgibt (1Mos 27). Zwar verstößt Rebekka damit gegen geltendes Recht, aber sie folgt damit, der Verheißung Jahwes aus 1Mos 25,23.
1Mos 25,23: Vnd der HERR ſprach zu jr [Rebekka] / Zwey Volck ſind in deinem Leibe / vnd zweierley Leute werden ſich ſcheiden aus deinem Leibe / vnd ein Volck wird dem andern vberlegen ſein / Vnd der Gröſſer wird dem Kleinen dienen.
SK Version 21.12.2024 ● |
||||||||||||||||||
recht |
recht (Adverb und Adjektiv) Die ursprüngliche Bedeutung von recht ist das Gegenteil von krumm bzw. von link (Adjektiv).
Damit lässt sich mit recht alles beschreiben, was sich im Gegensatz zu einer krummen, linken, schrägen, unliebsamen, ungehörigen, nicht offensichtlichen Sache usw. (bzw. einem Zustand) abhebt bzw. was davon abgehoben werden soll.
Daraus ergeben sich viele Bedeutungen, die wir hier nicht alle auflisten können. Die Verwendung bei Luther
wahr, eigentlich (von Personen im Gegensatz zu denen, die sich sonst nur so nennen):
richtig, passend (im Gegensatz zu falsch, unpassend)
wahr, richtig (im Gegensatz zu unwahr, falsch, unrichtig)
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
rechten |
rechten (Verb; veraltet) |
||||||||||||||||||
redeſtu |
redetest du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von reden (Verb)
Präsens: redeſtu: redetest du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).
Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. redeſtu : redestest du, hast du (doch) geredet
Da zumal redeſtu im Geſichte zu deinem Heiligen
a) Damals redetest du in einer Visionen zu deinem Heiligen b) Damals hast du doch in einer Vision zu deinem Heiligen geredet
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Reiger |
Reiher, der Fischreiher, der |
||||||||||||||||||
rein abe |
rein ab! (Wendung, veraltet) bedeutet: völlig ab! bis auf den Grund ab! reinlich abgemacht, entfernt!
übertragen: zerstört bis auf den Grund bzw. gründlich zerstört Die beiden Bestandteile der Wendung sind die Wörter rein und ab.
abe ist die mittelhochdeutsche Form von ab.
Die Partikel ab wird in dieser Wendung wie ein Adjektiv genutzt, ähnlich den Wendungen rein still, rein fleißig, rein gehorsam, die allesamt veraltet sind. Erhalten sich der adjektivische Gebrauch noch in Ausdrücken wie »der abbe Knopf« (eigentlich »der abe Knopf« zu schreiben; es meint den Knopf, der ab ist, der abgegangen ist) u. ä., die man umgangssprachlich bzw. mundartlich noch hier und da hört.
rein bedeutet hier entfernt, frei von etwas, sauber; reingemacht, so dass nichts zurückbleibt
Die da ſagen / Rein abe / rein abe / bis auff jren boden.
a) Die da sagen: Rein ab! Rein ab! Bis auf ihren Boden. b) Die da sagen: Reißt nieder! Reißt nieder! Bis auf ihren Grund! c) Die da sagen: Zerstört sie gründlich! Zerstört sie gründlich! Bis auf ihre Fundamente.
SK Version 21.12.2024 ● |
||||||||||||||||||
reiſen |
reisen (Verb) eigentlich: aufstehen, sich erheben
a) tröpfelndes Fallen (von Regen), allmählich herabsinken, niedersinken b) von etwas herfallen, zufallen, abfallen, wegfallen, usw. c) sich in Bewegung setzen, losgehen (jede Form von Aufbruch, Beginn der Bewegung)
Vnd erzürneten jn mit jrem thun / Da reis auch die Plage vnter ſie.
Und sie erzürnten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
reiſigReiſig |
reisig (Adjektiv und Adverb; veraltet) Reisig (Substantiv zu reisig) zum Verb reisen, der Tätigkeit des Reisens im Sinne einer Expedition, eines Kriegszugs: gerüstet, besonders zu Pferde gerüstet, für den Krieg, bereit zum Aufbruch
reisig sein, reisig werden, reisig machen auch geradezu in dem Sinne beritten sein, werden, machen
Substantivisch gebraucht: der Reisige, der Bewaffnete, vor allem der Bewaffnete zu Pferde, einer, der Reiterdienste erledigt
In der Lutherbibel werden mit dem Substantiv regelmäßig ganze Teile eines Heeres bezeichnet, die Kavallerie mit dem gesamten Tross an Reittieren, Streitwagen, Versorgungswagen und Hilfstruppen.
Reiſig Reiter / Wagen, SK Version 11.12.2024 ● |
||||||||||||||||||
reiſſen |
reißen (Verb) a) Linien oder Furchen ziehen b) zerteilen, in Stücke trennen
Er reis die Felſen in der Wüſten / Vnd trencket ſie mit Waſſer die fülle. Vnd lies Beche aus den felſen flieſſen
Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich mit Wasser. Und <er> lies Bäche aus den Felsen fließen.
SK Version 21.11.2024 ● |
||||||||||||||||||
Reuchopffer |
Rauchopfer, das Räucheropfer, das Beim Rauchopfer werden wohlriechende Stoffe, die meist selten und teuer sind, nach kultischen Regeln langsam verbrannt.
Bekannt sind Weihrauch, Myrrhe und Balsam, die im gesamten Mittelmeerraum als Rauchopferwaren gehandelt und in großen Mengen verbraucht wurden. Vnd [die Weisen] theten jre Schetze auff / vnd ſchenckten jm Gold / Weyrauch vnd Myrrhen.
Die Weisen aus dem Morgenland brachten als Geschenke nicht nur Weihrauch und Myrrhe, weil sie wertvoll waren (Schetze), sondern weil damit Zeremonien mit Rauchopfern durchführbar waren, die für das Wohl des jungen Königs der Juden (das war Jesus für Weisen:
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
rewen |
reuen (Verb) a) Schmerz, Reue empfinden b) Schmerz, Reue erregen c) unpersönlich mit Akkusativ der Person: bereuen
Vnd gedacht an ſeinen Bund mit jnen gemacht / Vnd rewete jn nach ſeiner groſſen Güte.
wörtlich: Und er dachte an seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hatte, und es reute ihn in seiner großen Güte.
nach c): Und er dachte an seinen Bund, den er mit ihnen gemacht hatte, und er bereute es in seiner großen Güte.
SK Version 21.11.2024 ● |
||||||||||||||||||
Rhordomel |
Rohrdommel, die ein Vogel aus der Familie der Reiher (Ardeidae). Hinweis: Man beachte die Stellung des Buchstabens »h«: In Luthers Schreibweise steht er vor dem »o«. Jch bin gleich wie ein Rhordomel in der wüſten / Jch bin gleich wie ein Kützlin in den verſtöreten Stedten.
Luther übersetzt das hebräische קָאָת (kaaht), das einen Wasservogel bezeichnet, der auch wüste Gegenden bevölkert, mit Rohrdommel, einer ihm bekannten Reiherart.
Um welches Tier es sich genau handelt, scheint unklar zu sein. Manche Sprachwissenschaftler bevorzugten Kropfgans oder Pelikan.
In vielen Übersetzungen, so auch in der Lutherbibel 1964 und in der Elberfelder Bibel, steht nun Eule.
Im hebräischen קָאָת steckt das Wort קֵא (keh), das »das Ausgespieene, das Erbrochene« bedeutet. Der Vogel, der die Reste seiner Mahlzeiten wieder ausspeit, ist die Eule. Zudem passt dieser Vogel besser neben das Käuzchen (Kützlin) in diese Metapher.
Doch je nachdem, wie man dieses Bild interpretiert, das der Autor des Psalms 102 vermitteln möchte, mag man frei darin sein, ob man eher einen Wasservogel in der Wüste sieht (was auf Entbehrung abzielt), oder eine Eule.
Die Eule jagt nachts, wenn in heißen Wüstengebieten manche Tiere aktiv werden. Wie das Käuzchen in der zerstörten Stadt jagt sie einsam und muss gerade nachts hell wach sein. Diesen bedauernswerten Zustand erleidet wohl der Autor des Psalm und beklagt ihn im Vers 8.
Luther bietet hier eine sprachlich formvollendete, geradezu lyrische Übersetzung, wozu das kleine »e« am Ende des Worts »Dach« wie auch die Positionierung der Satztrennzeichen entscheidend beitragen:
Jch wache / Vnd bin / wie ein einſamer Vogel auff dem dache.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
rhümeſtu |
rühmst du (Verb) rhümeſtu
* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. 2. Person Singular Indikativ Aktiv von rühmen (Verb)
Präsens: rhümeſtu: rühmst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).
Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden.
So rhüme dich nicht wider die Zweige. Rhümeſtu dich aber wider ſie / So ſoltu wiſſen / das du die wurtzel nicht tregeſt / ſondern die wurtzel treget dich.
So rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst dich ihnen gegenüber aber <doch>, dann musst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich!
1Kor 4,7:
Was haſtu aber / das du nicht empfangen haſt? So du es aber empfangen haſt / was rhümeſtu dich denn / als der es nicht empfangen hette?
<Sag,> Was besitzt du denn schon, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn als einer, der nichts empfangen hätte?!
SK Version 22.03.2025 ● |
||||||||||||||||||
Rhumredtige |
Ruhmredige, der Prahler, Wichtigtuer, Blender
von: ruhmredig sich selbst (mit Reden) rühmend, prahlerisch, wichtigtuerisch
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
richteſtu |
richtest du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von reden (Verb)
Präsens: richteſtu: richtest du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).
Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. richteſtu : richtest du, / richtest du gewiß, bestimmt
Sondern mit maſſen richteſtu ſie /
a) Sondern mit Maßen richtest du sie b) Sondern du richtest sie ganz gewiß mit Maßen
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Riebe |
Rippe, die Knochen im Brustkorb.
Vnd nam ſeiner Rieben eine / vnd ſchlos die ſtet zu mit Fleiſch. 22Vnd Gott der HERR bawet ein Weib aus der Riebe
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Riſe
Rieſe |
Riese, der Riſe
Rieſe
mhd: rise 1) sich durch Körpergröße auszeichnendes Wesen der Mythologie 2) sich durch Körpergröße auszeichnender Mensch, sehr großer Mensch 3) übertragen auf Fähigkeiten: Mensch mit besonders großen Eingenschaften bestimmter Art (»ein geistiger Riese«) 4) übertragen auf Tiere, Pflanzen (Bäume), Berge, usw.: ein Riese seiner Art 5) übertragen auf Gegenstände aller Art, die durch ihre Größe herausragen
Ein Riſe wird nicht errettet durch ſeine groſſe Krafft.
Ein Riese wird sich nicht mit seiner großen Kraft retten können.
1Sam 17,23
Da trat er auff der Rieſe mit namen Goliath / der Philiſter von Gath /
Da trat er auf, der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gath.
SK Version 21.11.2024 ● |
||||||||||||||||||
Riſs |
Riss, der Substantiv zu reißen das Gerissene, durch Reißen entstandene
Vnd er ſprach / Er wolt ſie vertilgen / Wo nicht Moſe ſein Auſſerweleter den Riſs auffgehalten hette / ſeinen grim abzuwenden
wörtlich: Und er sagte, er wolle sie vertilgen, wo nicht Moses, sein Auserwählter, den Riss aufgehalten hätte, um seinen Grim abzuwenden.
sinngemäß: Und er er hatte vor sie zu vertilgen, wenn nicht Moses, sein Auserwählter, die Diskrepanzen aufgelöst hätte, um seinen Grim abzuwenden
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Roſs |
Ross, das das Pferd
SEid nicht wie Roſs vnd Meuler / Welchen man Zeum vnd Gebis mus ins Maul legen
a) Seid nicht wie Pferd und Maultiere, denen man Zaumzeug und Kandare ins Maul legen muss. b) Seid nicht wie ein Pferd oder wie Maultiere, die mit Zaumzeug und Kandare gebändigt werden müssen.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Rotte |
Rotte, die a) (militärische) Abteilung, geordneter Teil einer Masse b) geordnete Gruppierung von Menschen c) Schar, Haufen, Menge d) im üblen Sinn: Gruppe von Aufrührern, Verschwörern, Rebellen, usw.
Die Erde that ſich auff / vnd verſchlang Dathan / Vnd decket zu die rotte Abiram.
Die Erde tat sich auf und verschlang
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
Ruge |
Ruhe, die a) Stille: ungestörter Zustand b) Bewegungslosigkeit: unbewegter Zustand c) Entspannung: von Hektik oder reger Tätigkeit befreiter, erholsamer Zustand
ruge
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||
rugen
rugete
geruget |
ruhen (Verb) ausruhen, von reger Tätigkeit erholsam entspannen
Substantiv: Ruge, die Ruhe er rugete: er ruhte er hatte geruget: er hatte geruht
Biſtu aber nicht from / So ruget die Sünde fur der thür
Luther benutzt rugen in 1Mos 4,7 im Sinne von still und ruhig, aber wachsam und aufmerksam daliegen, wie er in seinem Scholion erklärt.
Die Bedeutung ist somit lauern.
SK Version 25.09.2024 ● |
||||||||||||||||||